Ohne Kompromisse wären Konflikte nicht zu bewältigen – es droht stets die Eskalation. Aber was ist ein Kompromiss? Was muss gegeben sein, damit er zustande kommt? Wann ist er faul? „Es gab bislang kaum Forschung zum Kompromiss“, sagt Prof. Dr. Constantin Goschler, Professor für Zeitgeschichte der Ruhr-Universität Bochum. Gemeinsam mit Forschenden aus Duisburg-Essen und Münster hat er sich drei Jahre lang den „Kulturen des Kompromisses“ gewidmet. Das Projekt, das von Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wurde, ist abgeschlossen und hat seine Ergebnisse auf der Webseite veröffentlicht: https://www.uni-due.de/kompromisskulturen
Bochum/Germany, 17. Oktober 2025. – Wenn zwei Seiten sich um eine Ressource bemühen und die Ressource scheinbar nur für eine Partei nutzbar werden kann, dann kann ein Kompromiss eine Lösung sein. Sich auf Kompromisse einzulassen ist in der Regel für beide Seiten nützlich. Denn wenn man ernsthaft um etwas bemüht ist, dann wird man bereit sein wollen die eigenen wahrhaftigen Gründe finden zu wollen, die eigenen Motive warum man um etwas bemüht ist. Wer dabei pokert riskiert alles zu verlieren.
Gerade dann, wenn Konflikte entstanden sind, ist offensichtlich geworden das man bereit war, etwas zu opfern, was man zuvor begehrt hat. Man hat demnach zwar Verhandlungsmasse, aber es benötigt eine Schlichtungsstelle, in irgendeiner Form Dritte, vermittelnde, weil die Fronten meist schon verhärtet sind.
Konflikte können auf verschiedene Arten beendet werden:
Eine Seite setzt sich zulasten der anderen durch, friedlich oder mit Gewalt; in der Regel wird hierbei der Konflikt nur aufgeschoben, nicht gelöst und beginnt zu einem späteren Zeitpunkt von neuem.
Alle Parteien finden eine für sie vorteilhafte Lösung, sie vereinbaren einen Deal; der Konflikt wird gelöst, indem ein von allen akzeptierter Konsens gefunden wird. Wenn all dies nicht passiert, schlägt die Stunde des Kompromisses:
In diesem Fall machen alle Seiten unter Umständen schmerzhafte Zugeständnisse, ohne jedoch ihre ursprünglichen Positionen aufzugeben.
Daniel Shapiro ist Konfliktforscher, mehrfach im Forum Alpbach vertreten und hat bereits, wie einige andere vor ihm auch, im Dauerkonflikt Israel und Palästina seit der Unabhängigkeit Israels 1948 um Frieden verhandelt.
Er beschreibt, „hinter allem sichtbaren, das in irgendeiner Form in Bewegung gebracht wird, steht etwas Göttliches. Der Grund, wenn der Mensch eine Illusion ist, die etwas tut, um die Wirklichkeit zu beeinflussen, und nur das sichtbare mächtig ist, dann ergibt sich aus der Summe der Handlungen der handelnde Geist. D.h. es wird etwas bewegt und verändert, aber im Grunde ist es ein Geist, der über allem wirkt. Dass der Mensch eine Illusion wäre, wird dann vorstellbar, wenn sich dieser als völlig unscheinbar zurücknimmt. (Vgl. Shapiro, S. 135, 2018).
Neben Shapiro haben dies auch einige Philosophen vor ihm bemerkt, das ist also nicht die Erkenntnis eines Menschen alleine, zeigt damit aber schon die Gewichtung. Es zeigt, Konflikte und Kompromisse sind im Grunde nichts anderes als der Kampf um Ressourcen. Jeder will etwas Bestimmtes haben und ist bereit dafür sein Leben zu geben oder Eingeständnisse zu machen. In der Tat stehen sich hier zwei Teile, gegenüber die im Grunde an eine Antike Bewegung erinnern.
Die Stoiker, vertreten durch einige gelehrte, standen dem Epikurismus gegenüber. Zwei Lebensphilosophien mit unterschiedlichen Methoden und Vorstellungen wie eine Welt zu bewältigen sei.
Der Stoizismus vertritt die Auffassung, das Wissen um die Gesetzmäßigkeiten, das eine vernünftige Lebensweise mit sich bringe, sei die einzige Tugend.
Der Mensch schätzt Leben, Gesundheit, Ehre, Besitz oder Lust. Er vermeidet Krankheit, Tod, Armut oder Knechtschaft. Beides wird weder als gut oder schlecht beurteilt, sondern soll als Gleichgültigkeit betrachtet werden. Um diese Ebene zu erreichen wäre aus heutiger Sicht der Aufstieg in die Selbstverwirklichung erforderlich, da der klassische Mensch zuvor hätte lernen müssen viele Opfer zu bringen um diesen Grad an Weisheit zu erlangen. Dem Stoizismus zur Folge nimmt man die Dinge so hin wie sie sind, oder wie man biblisch sagen würde, Gnade wem widerfährt was auch immer kommen mag. Gutes wie böses. Die einzige Glückseligkeit bestehe in der Tugend der vernunftbegabten Lebensweise.
Der Stoizismus fordert negativen wie positiven Ereignissen mit Leidenschaftslosigkeit (gr. apatheia) zu begegnen. Von der Weisheit eines Menschen, so geht man aus, das man diese nur durch die Vielfalt der Ereignisse und damit verbunden den Lebensverlauf erreichen kann. Zur Weisheit ist es notwendig das man werden und vergehen lernt, denn jeder mentale Tod bringt neues Leben mit sich. Weisheit kann also nur im hochbetagten Alter zustande kommen (Vgl. Philosophie Atlas, 2019).
Der Epikureismus hingegen fordert, benannt nach dem Philosophen Epikur, das Ziel des Lebens sei die Gewinnung von Lust. Unlust solle vermieden werden. Was durchaus an den heutigen Hedonismus erinnert.
Nicht aber wie man vielleicht denken könnte führe die hemmungslose Befriedigung von Bedürfnissen zur Lust. Sich zügeln zu wollen, zu können, Unlust in Kauf nehmend und das Streben nach Glück sei vernünftig und führe zum Glück. Für Epikur bestand die höchste Lust im philosophischen Erkennen (Vgl. Philosophie Atlas, 2019).
In der Bereitschaft sein Leben geben zu wollen für diesen Kompromiss ist aber bereits auch schon die mögliche Lösung zu erkennen. Denn die Frage ist für wen oder was soll eine Lösung erzielt werden? Für mich alleine oder zum Wohl derer für die der Kompromiss zu finden sein soll! So wird deutlich, es geht um dem Kampf zwischen einer egozentrischen Haltung und dem einer gesellschaftlichen Objektiven Anpassung. In der Tat ein Machtkampf! Konflikte sind Land- und Raumgewinne oder Verluste, die sich nicht nur um Grund und Boden drehen. Vielmehr will man das die eigene Haltung ihre Erweiterung findet, wie bsw. im gegenwärtigen Kampf zwischen Autokratie und Demokratie. Unterschiedliche Nationen haben unterschiedlichste Auffassungen, kommen aus unterschiedlichen Zeitkapseln und Lebensphilosophien.
Das eingangs erwähnte Forschungsprojekt hat den Kompromiss sowohl theoretisch-systematisch wie historisch erforscht. Kompromisse haben bestimmte Eigenschaften gemeinsam, sie unterschieden sich aber stark je nach Kontext. Das gilt historisch, deshalb hat das Projekt die Geschichte des Kompromisses vom Mittelalter bis in die Gegenwart untersucht. Das gilt für verschiedene Kulturräume, darum wurden Kompromisse vergleichend in Europa, Nordamerika, Japan und Israel erforscht. Das gilt für Situationen, weswegen sowohl Kompromisse in Politik und Diplomatie als auch im Recht, in Literatur und Imagination und schließlich in der alltäglichen Interaktion betrachtet worden sind.
Warum Kompromisse möglich sind oder scheitern
Die Gründe, warum Kompromisse möglich sind oder scheitern, liegen auf verschiedenen Ebenen: Wichtig ist erstens die Einstellung der Beteiligten. „Wer keinesfalls bereit ist, Zugeständnisse zu machen und damit keine Abstriche an den eigenen Zielen vorzunehmen, ist kompromissunfähig“, sagt Prof. Dr. Ulrich Willems (Universität Münster).
Entscheidend sind zweitens die Themen: So ist bei zähl- und teilbaren Gütern ein Kompromiss verhältnismäßig leicht möglich. Ganz anders verhält es sich bei Werten und Moral. Religiöse Überzeugungen etwa lassen häufig Kompromisse nicht zu, da sie als Verrat an Prinzipien erscheinen. „Umso bemerkenswerter ist, dass Kompromisse in religiösen und konfessionellen Streitfragen unter bestimmten Umständen in der Historie dennoch möglich waren“, sagt Prof. Dr. Ute Schneider (Universität Duisburg-Essen).
Eine entscheidende Voraussetzung dafür, Kompromisse zu finden, sind drittens Verfahren und Mechanismen: Gibt es, etwa in der Diplomatie, anerkannte Instrumente, wie Verhandlungen geführt werden, ist es leichter, Übereinkünfte zu finden. Von besonderer Bedeutung sind hier Dritte, die Einigungen vermitteln können. Viertens spielt die Vorstellungswelt der Menschen eine große Rolle dabei, ob Kompromisse möglich sind. Während im europäischen Mittelalter etwa schmerzhafte Zugeständnisse in der Politik schwer zu vermitteln waren, gilt es in vielen heutigen Demokratien als unerlässlich, Abstriche an den eigenen Positionen vorzunehmen, um eine Einigung zu erlangen. Dort, wo Konsens und Harmonie hochgeschätzt werden, etwa im heutigen Japan, wird der Kompromiss anders eingesetzt als in Gesellschaften, die Pluralität und offene Debatten positiv bewerten.
Quellen:
Atlas Philosophie, dtv-Verlag, 2019
Shapiro, Daniel; Verhandeln, 2018
Bildquelle
Konfliktlösungssuche zwischen zwei Parteien, Mote Oo Education Pixabay


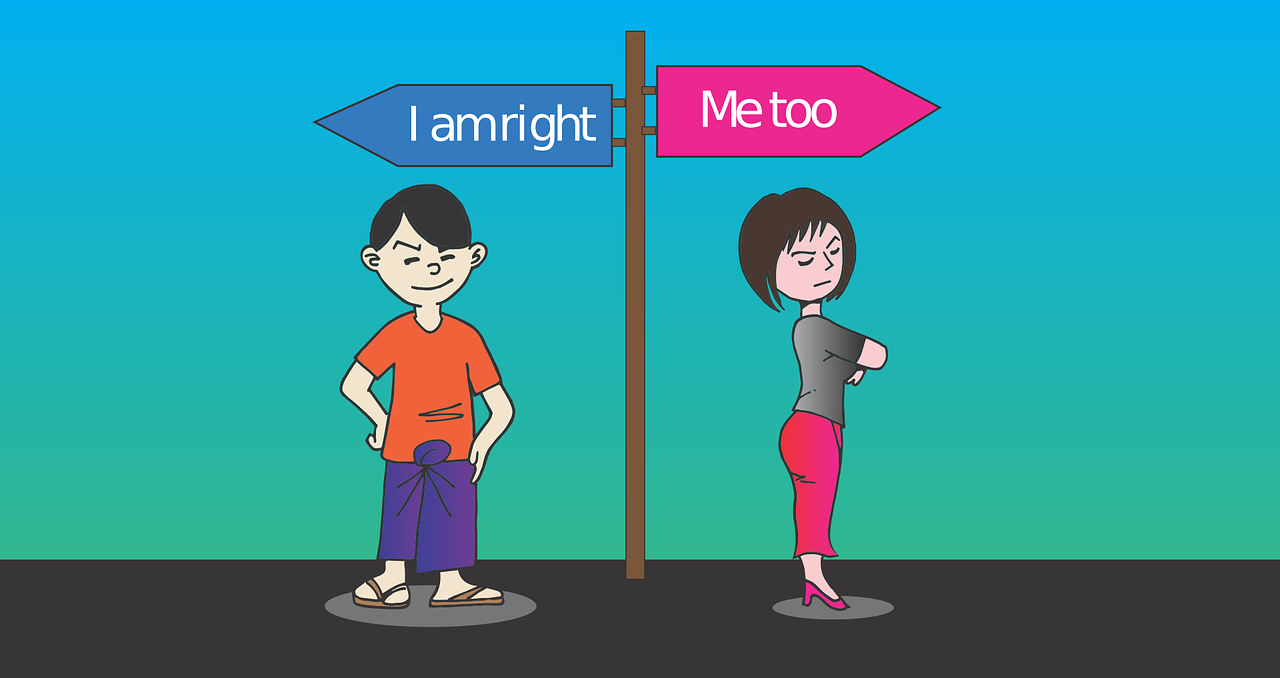
Schreibe einen Kommentar